„Das Spielen mit KI ist ein Lernmotor und schafft Gemeinschaft“
Interview mit dem Ludologen Prof. Dr. Giovanni Vindigni
Warum posten Menschen sich selbst als KI-generierte Actionfiguren oder Cartoons auf LinkedIn? Ist das Spielerei? Zeitverschwendung? Oder steckt mehr dahinter? Das Spielen gilt vielen als Eskapismus, Zeitvertreib oder sogar als Ablenkung von der Arbeit. Doch was passiert, wenn wir Spiel als Kommunikationsform begreifen; als sozialen Raum, als Ausdruck von Zugehörigkeit, als Weg zur Selbstwirksamkeit? Ein Gespräch mit dem Ludologen und Medientheoretiker Prof. Dr. Giovanni Vindigni über digitale Spielmechaniken, künstliche Intelligenz, Medienkompetenz, Selbstwirksamkeit und die Zukunft unserer Gesellschaft.
Kerstin Hoffmann: Giovanni, hast du dich selbst schon als Actionfigur generiert oder als Cartoon im Ghibli- oder Manga-Style?
Giovanni Vindigni: Ehrlich gesagt noch nicht, weil ich keine Zeit hatte und es mittlerweile redundant finde, weil es jeder macht.
Aber das, was du ansprichst, hat sicherlich mit dem zu tun, was Spiel eigentlich im Kern ist. Spiel, altdeutsch „speel“ hat ursprünglich eher den Charakter von Bewegung, tanzen, experimentieren, musizieren. Deswegen sagen wir im Deutschen noch „Spiel mir mal was vor!“.
Und im Kern gilt Spiel als solches als Lernmotor. Und ein Lernmotor hat erst mal per se keinen Selbstzweck. Aber dann kommen wir nämlich zu dem, was überhaupt Spiel in der Tiefe sein soll, welche Funktion in dem Spiel liegt. Ich finde ganz wichtig, ludologische, spielerische Prinzipien von einem teleologischen Prinzip her zu denken: also welchem Zweck oder Ziel dienen sie?
Hoffmann: Wenn Spiel zunächst zweckfrei ist, wohin führt diese Frage dann?
Vindigni: Einfach ausgedrückt: Spiel und Kommunikation zielen sowohl auf das Denken, das Handeln und das Verhalten als auch auf die Gefühle ab – sie haben immer einen bestimmten Zweck, Sinn oder Wertbezug. Insofern ist das schon das teleologische Prinzip. Und wenn ich schaue, was im Altgriechischen „teleios“ bedeutet, dann finden wir hier eigentlich das, was Spiel im Kern ausdrückt oder ausdrücken soll. Es soll Erfüllung bringen, wirksam sein. Es geht um Vollkommenheit, um Reifwerden. Darum fehlerlos werden zu können, tüchtig zu sein, selbstbestimmt zu sein, unumstößlich zu sein. Und vor allen Dingen im sozialen Sinne, also im kollektivistischen Sinne, geht es eigentlich darum, etwas vollkommen zu machen. Aber dort, wo Hierarchien bestehen – und die sind im Spiel gegeben, weil wir es ja mit regelgeleitetem Spiel zu tun haben –, geht es um das Heranwachsen und zur Reife zu kommen. All das macht Spiel in diesem Sinne aus.
Hoffmann: Das hört sich aber nicht mehr sehr spielerisch an …
Vindigni: Der eigentliche Streitpunkt unter den Gelehrten in den letzten 100 Jahren war: Gibt es ziel- und zweckfreies Spiel, ja oder nein? Und da haben sich die Gelehrten immer gestritten, unter anderem, als es um Debatten ging bezüglich des Flow-Erlebens, also des Eintauchens und des vollen Aufgehens und Sich-Verlierens in dem Geschehen. Aber was wir auf jeden Fall finden, wenn wir uns diese Kette aus Zielzweck, Sinn, Wertbezogenheit, Kommunikationspositionierung vergegenwärtigen: dass es ein Lernmotor ist, der einen geschützten Raum zum Ausprobieren bietet.
Und das ist genau das, was wir jetzt bei den Menschen finden, die ihre eigenen Actionfiguren generieren. Sie verlieren sich, sie probieren sich aus, sie gehen ihrem eigenen Lernmotor nach und entwickeln sich in gewisser Weise damit weiter. Und genau darin liegt der Wert.
„Und das ist genau das, was wir jetzt bei den Menschen finden, die ihre eigenen Actionfiguren generieren.“
Hoffmann: Jetzt könnte ich ja – und das habe ich, ehrlich gesagt, auch gemacht – so eine Actionfigur einfach für mich selbst im stillen Kämmerlein generieren. Aber wenn jemand spielerisch generierte Inhalte öffentlich teilt ist das ein Akt sozialer Kommunikation? Ist das ein Akt des gemeinsamen Spielens? Hat das was mit Zugehörigkeit zu tun? Oder anders gefragt: Warum postet der 528. User auch noch seine Actionfigur auf LinkedIn oder Instagram?
Vindigni: Also ich bin sehr stark inspiriert und geprägt von einem der führenden Mediensoziologen Deutschlands, Professor Andreas Hepp. Hepp hat den schönen Begriff der „Aneignungsformation“ geprägt. Er sagt: „Es geht hier bei der Aneignungsformation um den diskursiven Kontext, in den die Aneignung von Medien eingebettet ist.“ Und dann müssen wir uns auch über die Literacy, die Kompetenz unterhalten, also über Media Literacy und Digital Literacy etwa.
Das heißt, das, was wir mit Medien gestalten, generieren, machen, kann nicht in einem Kontext für mich selbst stehen. Ich glaube, vielfach liegt ein defizitäres Verständnis vor, wie wir Medien verstehen. Der eigentliche Trugschluss ist, dass wir Medien als eine verstärkende Absicht meiner Kommunikationsbotschaft, also Medien als Applikation meiner Aussage betrachten. Damit würden eigentlich Medien – und so wird das ja verstanden, funktional im Sinne der Meinungsbildungs-, Informations-und Kritik-und Kontrollfunktion – nur die gegenwärtige Lebenswirklichkeit abbilden, also so wie ein Foto. Oder wenn ich dir eine Powerpoint zeige, dann ist es die Absicht, meine eigentlich intendierte Botschaft nur verstärken zu wollen. Jetzt erleben wir aber mit dem Web 3.0 die Transformation weg vom „Ich bin drin“-Netz hin zu einem „Ich mach mit“-Netz, zu einem eher partizipativen Netz.
Hoffmann: Das ist ja genau das, was Social Media ausmacht, oder?
Vindigni: Ja. Diese gesamte Teilhabe, von der wir reden, das ist das, was die Community of Practice ausmacht: Die Gemeinschaft, an der ich teilhabe – und da sind wir auch wieder bei den Figuren – hat damit keine rein amplifizierende, also verstärkende Dimension mehr. Das heißt, Medien bilden Lebenswirklichkeit nicht nur ab, profan, sondern konstituieren Lebens-und Arbeitswirklichkeit.
Defizite mit dem Medienverständnis und damit auch einhergehend dem Kommunikationsverständnis hängen deutlich mit einer negativen Konnotation des Medienbegriffs zusammen. Medien werden verstanden als eskapistisch. Also der Überzeugung: Sobald wir etwas damit generieren, gestalten, uns mit Medien umgeben, in diese Medien eintauchen, dann ist es nichts anderes als Wirklichkeitsflucht, es ist nichts anderes als Kompensation.
Hoffmann: Wenn ich in meiner Arbeitszeit Cartoons oder Actionfiguren generiere, statt KI für meine Arbeit einzusetzen – ist das dann nicht eine Art von Ablenkung, von Wirklichkeitsflucht?
Vindigni: Ich glaube, dass wir heutzutage vorsichtiger sein müssen mit dieser Aussage und so vielleicht eher auch einen positiven Zugang erwägen sollten. Selbst wenn die Menschen sich jetzt mit ihren generierten Actionfiguren zeigen, generiert es ja in gewisser Weise eine Authentizität, dahingehend, dass ich zeige, was mir wichtig ist.
Wir müssten uns mehr darüber unterhalten, was überhaupt Wirklichkeit konstituierend ist. Und wenn ich jetzt nochmal diese Actionfiguren aufgreife: Ich sehe, dass Menschen sich mitteilen und dadurch auch Teilhabe in der Gemeinschaft generieren, indem sie etwas von sich preisgeben, von ihrer Wirklichkeit und von ihrer Wahrnehmung, so selektiv sie sein mag, aber sie verraten auch ein Stück weit über ihre Sozialisierung. Dann kann dieses Posten, was eben nicht im stillen Kämmerlein ist, sondern dieses Nach-außen-Gehen, durchaus beinhalten, dass die Form-Raum-Geschichte weiter geprägt, transformiert, erweitert wird.
„Ich sehe, dass Menschen sich mitteilen und dadurch auch Teilhabe in der Gemeinschaft generieren, indem sie etwas von sich preisgeben.“
Also dass eigentlich ein emergenter Raum sich weiter ausweitet. Und das ist ja das, was ich auch so schön finde: Dass wir hier zunehmend partizipative Strukturen haben. Ich glaube aber, dass sich zu wenig Gedanken gemacht wird darüber: Wer ist eigentlich der Schöpfer dieser Idee, dass man zum Beispiel eine Marvel-Figur machen kann? Worauf basiert das? Worauf beziehe ich mich, traditions-, rezeptionsgeschichtlich? Übernehme ich einfach nur oder denke ich mit?
Hoffmann: Wenn sich Menschen darüber aufregen, dass andere zum Beispiel auf LinkedIn ihre spielerisch erzeugten Figuren teilen, dann sehen sie ja die Medien eben primär nicht als Eskapismus. Sondern sie werfen eigentlich denjenigen, die in einem Business-Netzwerk so was posten, Eskapismus vor, während sie eher für sich beanspruchen, eine Zweckgerichtetheit zu haben. Sie finden also: LinkedIn ist ein Business-Netzwerk. Hier geht es um berufliche Sachen. Hier geht es um das Abbilden von Realität und eben nicht um Eskapismus und Spiel. Das ist ja eigentlich genau das Gegenteil dessen, was du über Medienrezeption als eskapistisches Werkzeug gesagt hast, oder?
Vindigni: Ja, das ist genau das Dilemma, zu verstehen und zu hinterfragen: Was heißt Kommunikation? Was heißt Medienkommunikation im Kern? Und ich glaube, wir müssen wieder zurück zu den Anfängen, dass es hier wirklich um Teilhabe geht, um Mitteilung, um Interesse, das ich natürlich auch weitergeben darf. Es geht um Verständigung. Das würde ich auch den Kritikern so entgegnen.
Ich würde sagen, die eigentliche Funktion ist doch, dass Affirmation entsteht. Was heißt denn Affirmation? Es geht doch darum, ganz gleich was und worüber sich jemand mitteilt, auch wenn es so ein Business-Netzwerk ist, dass er die Chance hat, erst mal uneingeschränkt angenommen zu sein, ohne dass ich vorab eine Bewertung bringe. Es geht darum, einen Raum zu schaffen, der Authentizität zulässt, ohne dass ich vorab eingrätsche. Und das bedingt wiederum – und das ist mir schon vor vielen Jahren aufgefallen –, das ist ja die Schwierigkeit bei, ich sage jetzt mal, diesen eher spießigeren Unternehmern.
Das sind meist die, die noch von dieser wettbewerbsorientierten Marketingkommunikation-Perspektive ausgehen. Die auch die Kommunikationskontrolle in ihrem Unternehmen ausüben. Statt zu sehen, dass der heutige Markt, also das, wie letztendlich Gemeinschaft sich konstituiert, eben in diesen Medienräumen, vor allen Dingen aufgrund der Kollaboration der prozessualen Ebene bedarf.
„Das ist natürlich unbequem, wenn du ständig in das Herz deiner Kunden, deiner Zielgruppe, deiner Mitarbeiter hören musst, weil das mit Aufwand zu tun hat.“
Das bedingt wiederum, dass wir alle heutzutage agiler sein müssen, auch Unternehmen. Und das ist natürlich unbequem, wenn du ständig in das Herz deiner Kunden, deiner Zielgruppe, deiner Mitarbeiter hören musst, weil das mit Aufwand zu tun hat. Es hat wirklich auch mit der Absicht zu tun, mit dem anderen eins werden zu wollen. Und das liegt nicht jedem. Aber ich glaube, dass viele Unternehmen das zunehmend verstanden haben, weil die sich in einer labilen Situation befinden. Weil sie merken, der Streuverlust ist ganz arg. Werbung ist verbrannt. Um das mit dem letzten W der Lebensformel auszudrücken: Es geht um die Frage „Wie kann ich überhaupt heutzutage mit Wirkung kommunizieren?“
Und du kannst nur mit Wirkung kommunizieren, wenn die Kommunikation zielgruppengerecht ist, in meinen Augen, und wenn sie wirklich das Prinzip der Affirmation lebt, auch unternehmerisch, auch in der DNA, im Herzschlag, im Umgang mit den Mitarbeitenden und den Kunden gegenüber.
Hoffmann: Jetzt hast du aber eingangs gesagt, du hast erst keine Zeit gehabt, so eine Actionfigur zu generieren, und jetzt wäre es die soundsovielte. Also du sagst auch, du willst das nicht mehr machen, weil du andere nervst, oder?
Vindigni: Ich für mich finde es redundant. Ich würde eher was Neues schaffen, um eben noch mehr Authentizität zu schaffen.
Hoffmann: Ja, aber was hat dann dieses Nachmachen für manche für einen Sinn, für eine Funktion? Als 528. den Trend aufzugreifen und das auch noch mal für sich umzusetzen? Hat das was mit Bindung zu, mit Zugehörigkeit? Oder womit sonst?
Vindigni: Ich denke, es hat einmal etwas mit dem Lernmotor zu tun, der durchaus in unseren europäischen Kreisen kollektivistisch gedacht ist. Unser Bildungssystem ist durchaus sehr kollektivistisch geprägt. Wir sehen das ja auch in unserem Bildungsföderalismus. Wir sehen aber mittlerweile, und da sind sich die Bildungsforscher einig, auch darin, warum wir in Deutschland insbesondere den Anschluss verloren haben. Also die Qualität der Bildung ist nicht mehr das, was sie mal in den 60er Jahren war.
Hoffmann: Und spielen wir dafür zu viel oder zu wenig?
Vindigni: Ich würde sagen, wir spielen zu wenig, weil wir das Spiel falsch sehen und betrachten. Wenn wir das Spielen rein behavioristisch betrachten, im Sinne Skinners, weil es um das Drill-and-Practice-Prinzip geht, dann ist die Logik: Du musst, wie bei „Mensch ärgere dich nicht“ eine Routine durchlaufen. Und wenn du versagst, fliegst du raus und musst dann noch mal dreimal so lange würfeln, bis du eine 6 gewürfelt hast, um dann wieder rauszukommen. Oder bei Monopoly. Es sind immer Routinen und wenn du rausfließt, startest du am Anfang. Wozu führt das? Zu Frust. So ist Spiel eigentlich nicht gedacht.
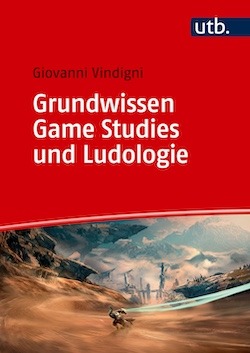 „Die Game Studies explorieren in diesem Zusammenhang die Interdependenz zwischen spielimmanenten Stimuli einerseits und der Emergenz distinktiver emotionaler Zustände andererseits, um sowohl positive Ausprägungen von Valenz wie z. B. Euphorie und Satisfaktion als auch negative Affektqualitäten wie z. B. Frustration und Anxietät in ihrer modulierenden Wirkung auf Immersion und Partizipationsbereitschaft zwecks User-Zentrierung gemäß DIN EN ISO 9241-11 zu bestimmen.“ (Zitat aus dem neuen Buch von Giovanni Vindigni: Grundwissen Game Studies und Ludologie. Theorie und Praxis. (erschienen am 14. April 2025, UVK Verlag, 1. Auflage 2025)
„Die Game Studies explorieren in diesem Zusammenhang die Interdependenz zwischen spielimmanenten Stimuli einerseits und der Emergenz distinktiver emotionaler Zustände andererseits, um sowohl positive Ausprägungen von Valenz wie z. B. Euphorie und Satisfaktion als auch negative Affektqualitäten wie z. B. Frustration und Anxietät in ihrer modulierenden Wirkung auf Immersion und Partizipationsbereitschaft zwecks User-Zentrierung gemäß DIN EN ISO 9241-11 zu bestimmen.“ (Zitat aus dem neuen Buch von Giovanni Vindigni: Grundwissen Game Studies und Ludologie. Theorie und Praxis. (erschienen am 14. April 2025, UVK Verlag, 1. Auflage 2025)Und da sind wir bei dem Thema generative KI und den Möglichkeiten heutzutage. Natürlich gibt es gute Spiele, die geben dir Kraft und eine Triebkraft, weiterzuspielen. Nehmen wir mal Super Mario. Wie oft durchläuft man ein Level, weil man jedes Mal rausfliegt? Wie oft hört man die gleiche Musik? Dennoch wird die Routine durchlaufen, bis du ans Ziel kommst. Das ist eigentlich nichts anderes als eine Form des Nudgings.
„Wir spielen zu wenig, weil wir das Spiel falsch sehen und betrachten.“
Und da sind wir bei dem Thema der Schnittstelle zwischen Games, Game-Mechanik, Technik und KI. Um das so auszudrücken: Was machen moderne, also nicht analoge, sondern digitale Spiele anders als die Spieleprinzipien des Brettspiels?
Hoffmann: Nämlich?
Vindigni: Die digitalen Spiele der Gegenwart evaluieren individualisiert: Ist der oder die Spielerin eine Novizin, ein Novize oder Experte? Das heißt, in dem First Level wird erst mal grundsätzlich geschaut: Wo steht der die Einzelne? Und das ist das, worüber digitale Spieleentwickler nachdenken und weshalb sie erkannt haben, dass jeder Spieler, jede Spielerin besonders ist und individualisiert zu Anfang, aber auch während des Spiels evaluiert werden muss.
Denn ist das Spiel zu schnell, zu kompliziert, dann entsteht Frust. Frust führt zur Kortisolausschüttung. Kortisolausschüttung bedeutet Stress. Also ist das Spiel zu schwer, entsteht Stress. Stress führt zur Bounce Rate, zur Absprungrate. Das Gleiche ist aber, wenn du Experte bist und das Spiel ist zu lahm oder zu langweilig, dann passiert das Gleiche in grün. Das heißt, es kommt gar nicht zum Flow-Erleben. Und das können wir eigentlich nutzen für so viele Dinge, die kommunikationspositionierend sind, um uns anschlussfähig zu machen.
Also Spiel nicht im Sinne von Nudging, von Konditionierung. Sondern sozial-konstruktivistisch, hier im Sinne einer individuellen, aber auch gesamtgesellschaftlichen Anschlussfähigkeit. Stichwort: Die ganzen Zugewanderten, die jetzt bei uns leben, von denen können wir ja nicht erwarten, dass die erst perfekt Deutsch reden müssen, bevor sie zur Schule gehen können oder an die Uni. Mit KI und Gamification, also Game-Mechanics, ist so viel möglich, dass wir wirklich im Sinne des Individuums hier ein Vorankommen schaffen.
„Spiel erschafft Zugehörigkeit.“
Und darin sehe ich – und da bin ich wieder an dem Anfang, was ich sagte – Ziel, Sinn, Zweck, Wertbezogenheit des Spiels. Spiel erschafft Zugehörigkeit. Es schafft eben keine Oberflächlichkeit per se sondern ich muss mir angucken, um welches Spieleprodukt handelt es sich? Welche Architektur von Spiel ist es? Und dann lässt sich auch eigentlich fast wie in einer strategischen Kommunikation, sowohl öffentlichkeitwirksam als auch überzeugend und mit Zustimmung kommunizieren. Damit hat es klar und deutlich eine affirmative Funktion.
Hoffmann: Und wie können Menschen, die jetzt so einem spielerischen Zugang skeptisch gegenüberstehen; die immer gleich genervt sind, wenn solche Trends aufkommen und sich verstärken: Wie können die einen eigenen Weg finden? Oder was müsste man tun, um da ein Bewusstsein zu ändern?
Vindigni: Ich glaube, das, worauf es ankommt, ist wirklich über Zielgruppengerechtigkeit und Barrierefreiheit im digitalen Raum mehr nachzudenken, die Durchlässigkeit zu erhöhen. Wenn diese Durchlässigkeit nicht gegeben ist, habe ich ja nur zwei Möglichkeiten: Entweder ich reagiere mit negativen Konnotationen, dann lasse ich mich sowieso nicht damit ein. Oder ich lasse mich darauf ein und habe dann wirklich eine eigene Position, die ich auch vertreten kann oder darf.
Die Sorge, die ich habe, ist, wenn wir über Barrierefreiheit, Durchlässigkeit, Inklusion reden im digitalen Raum, dass nun die generativen KIs, die zunehmend eine große Rolle spielen werden, hier zu zahlreichen Data Gaps und damit letztendlich zu Beeinflussung im Sinne des Strategic Framings oder Primings führen können.
Hoffmann: Kannst du das noch näher ausführen?
Vindigni: Also ich sehe in generativer KI die Möglichkeit, gerade für Menschen, die noch keinen Zugang haben und dadurch viele Dinge negativ bewerten, weil sie überfordert sind, dass generative KI den Zugang vereinfachen. Ich übertrage das mal im Sinne des Barrierefreiheitstärkungsgesetzes. Ich übertrage das mal auch im Sinne der etablierten Normen, die beim UX-Design, beim User Experience Design, eine Rolle spielen, sprich insbesondere der DIN EN ISO 9241 (insbesondere die DIN EN IS) 9241-11, 9241-110 und 9241-210).
Wir haben exemplarisch eine älter werdende Gesellschaft in Deutschland. Ich lebe hier in Schleswig. Die Banken bauen ihre Filialen zunehmend ab, auch die Post. Die bauen ihre Automaten zunehmend ab. Und ich sage jetzt mal, Frieda, 75, und Ewald, 79, sind überfordert, was sie machen sollen. Weil sie ja in den letzten 55 oder 60 Jahren ihre Überweisungsträger analog manuell ausführten. Natürlich kann generative KI nun zur Vereinfachung, zur Simplifizierung führen. Simplifizierung wird verstanden nach der DIN ISO 92.41 als Effizienz, Effektivität und Zufriedenstellung, und zwar nutzerzentriert. Also für Ewald und Frieda ist das gut. Die Möglichkeiten sind da, um vieles einfacher machen zu können.
Gleichzeitig sehe ich aber – ich habe mich mit unterschiedlichen KIs auseinandergesetzt und Research betrieben –, wenn wir darüber reden, welches Wirklichkeitsformat konstituiert als Muster diesen generativen KIs vorliegt, dann sind es ganze Weltbilder. Im Falle jetzt von ChatGPT oder Claude.AI haben wir es hier mit westeuropäischen und amerikanischen Bildern zu tun. Diese Muster, mit denen gearbeitet wird, legen aufgrund des Deep-Learning-Prozesses bestimmte Dinge, Inhalte, Konventionen fest.
Hoffmann: Und das führt dann dazu, dass, wenn ich Bilder von berufstätigen Frauen generiere, das immer so Mittzwanzigerinnen mit Pferdeschwanz, kurzem Rock und Absätzen sind?
„Ich sehe durchaus Missbrauchspotenziale.“
Vindigni: Genau. So, und das ist der Punkt. Wenn es hier um konsenstheoretische Muster geht, womit ja letztendlich generative KI wirbt, müssten sie genauso mit den Mustern aus dem asiatisch-persisch-orientalischen Bereich arbeiten. Das Schlimme ist, finde ich, dass die unterschiedlichen interkulturellen Konventionen gar nicht berücksichtigt werden. Also dass du zum Beispiel im persisch-orientalischen Raum eher eine Schamorientierung hast, als Gewissensorientierung, während wir im europäischen Raum eher eine Schuldorientierung haben.
Und ich sehe durchaus Missbrauchspotenziale, also im Sinne der politischen Kommunikation. Ich kann nur hoffen, dass über diese Themen mehr geredet wird, dass wir daraus mehr Chancen generieren. Und dass sich dann wirklich etwas eröffnet, was nicht zur Oberflächlichkeit führt, also nicht zu einer Gesellschaft, die nicht mehr selber mitdenkt, kontextualisiert, Dingen nachgeht, sondern Dinge einfach als gegeben hinnimmt. Davor habe ich Angst.
Hoffmann: Wie kann man so etwas verhindern?
Vindigni: Wenn die spielerische Mechanik vorgegeben wird, dann sehe ich ganz, ganz arge Probleme. Und ich hoffe, dass solche Beiträge wie dieser hier dazu beitragen, Bewusstsein zu schaffen.
Wir erleben eine interessante Zeit. Ich glaube, dass all das, was wir mit Medien verstehen, noch konvergenter, noch immersiver werden wird. Ich glaube, dass wir – das wird keine zwei bis fünf Jahre mehr dauern – noch mehr Mensch-Computer-Interaktion sehen, nicht nur in den alltäglichen Dingen, Autofahren und selbstgesteuerte Fahrzeuge etc. Sondern auch im medizinalen Bereich, Stichwort Transhumanismus-Debatte. Und ich hoffe, dass mehr Menschen auch kritisch über diese Dinge in der Gegenwart nachdenken.
Damit wir unsere Wirklichkeit gestalten – auch wenn ich sage, dass Medien Teil der Wirklichkeit und nicht ein Abbild der Wirklichkeit sind -, aber dass wir sagen, wir als Menschen gestalten diese Wirklichkeit. Und wir lassen nicht zu, dass generative KI-Wirklichkeit selbstgesteuert diese Wirklichkeit generiert.
Hoffmann: Aber besteht nicht die Gefahr, dass wir durch das ständige Spielen mit den technischen Möglichkeiten eben das Wesentliche aus dem Blick verlieren? Dass wir die ganze Zeit, weil es so schön ist, Actionfiguren generieren und schöne lustige Cartoons, aber keine echte Auseinandersetzung haben – weil dafür keine freie Aufmerksamkeit mehr vorhanden ist? Oder führt im Gegenteil gerade das Spiel damit zu einer echten Auseinandersetzung?
Vindigni: Ich glaube, es hat sozial-motivational etwas damit zu tun, was mein Anlass ist zu spielen oder diesen spielerischen Zugang zu wählen. Wenn die eigentliche Absicht ist, Gemeinschaft zu generieren, ein Teil der Teilhabe dieser Gemeinschaft zu sein, dieser Community zu sein, dann ist es positiv.
Es gibt aber zunehmend Menschen, also gerade jüngere Menschen, die sich verlieren. Dazu Gründe, die mit der Vereinsamung der Gesellschaft zu tun haben, beispielsweise, dass wir kaum – das ist ja fast schon ein Schimpfwort – kaum Leitbilder haben.
Dann auch noch, ehemals aus einer Leistungsgesellschaft kommen, die Inklusion, für die ich durchaus bin, aber so groß geschrieben wird, dass das Besondere gar nicht mehr gedacht wurde. Was wiederum dazu geführt hat, dass wir mehr Konformität haben.
Hoffmann: … und wie helfen wir jüngeren Menschen, wieder auf Kurs zu kommen und Selbstwirksamkeit zu entwickeln?
Vindigni: Ich glaube, es ist wichtig, den Einzelnen zu sehen, sehen zu wollen, nicht verallgemeinern zu wollen und dann eher zu schauen, wie können wir die Stärken, die Chancen nutzen. Ich sehe momentan eher eine Tendenz der Überforderung. Nehmen wir die klassischen Schulen. Wir reden darüber, wie wir unser Schulsystem besser machen. Wir reden, Stichwort, über Digitalisierungsstrategien. Aber die Kompetenz, Digital Literacy, bei den Lehrenden liegt nicht vor. Das heißt, die jungen Menschen machen den Eltern oder den Lehrern vor.
Hoffmann: Wenn die denn überhaupt offen dafür sind und nicht alles sofort verteufeln …
Vindigni: Mein Lieblingsthema. Also die Frage: Wie kommt es überhaupt zu einem offenen Diskurs über diese Dinge? Wir kommen nicht weiter, wenn wir alles Mögliche verbieten. Wir können so vieles kritisch sehen. Wir können über Dinge ethisch diskutieren, wir können soziologisch diskutieren, wir können es medien-und kommunikationspositionierend ausdiskutieren. Aber mein Ansatz ist: nicht verbieten, sondern Besseres bieten.
„Im Spiel kann Ideation, Co-Creation und Invention entstehen.“
Hoffmann: Was können wir also alle tun, um dieses Bessere zu erreichen?
Vindigni: Das funktioniert, wenn wir, wie wir beide heute oder du mit deiner Community, uns wirklich austauschen und gemeinsam als Gesellschaft ins Machen kommen. Und das ist das, was mich eigentlich führt. Deshalb sehe ich auch in dem Spiel, so wie ich das modern verstehe, die Chance von Kollaboration, die Chance von Community of Practice, von Teilhabe durch Gemeinschaft. Das ist das Spiel, denn darin kann dann Ideation, Co-Creation und Invention entstehen.
So kann Neues und Anschlussfähiges entstehen. Und wenn wir sehen, dass hier Anschlussfähigkeit ist und wir unser Land, unsere Gesellschaft, unsere Gemeinschaft voranbringen, dann haben wir auch weniger Angst. Das ist zumindest das, was ich versuche, auch meinen Studierenden auf Augenhöhe mitzugeben.




